Fehlende Exoplaneten: Umfassende Erklärung für Fulton-Lücke vorgestellt
Seit Jahren wird gerätselt, warum es zu wenige Exoplaneten gibt, die etwa doppelt so groß sind wie die Erde. Nun gibt es wohl eine umfassende Antwort.
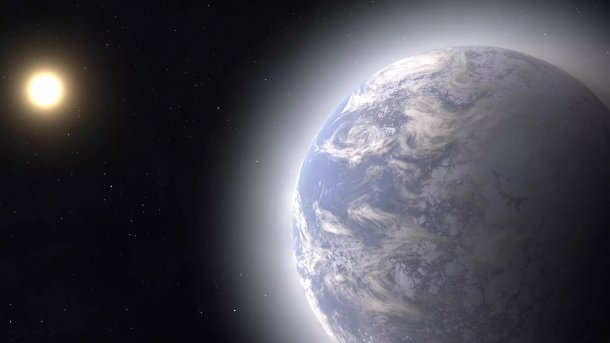
Künstlerische Darstellung eines Exoplaneten, bei dem Wassereis nach der Annäherung an den Stern schmilzt und eine Atmosphäre ausbildet, die ihn größer erscheinen lässt.
(Bild: Thomas Müller (MPIA))
Zwei Prozesse, die unterschiedliche Typen von Exoplaneten unter bestimmten Bedingungen aufblähen oder schrumpfen lassen, können eine "ominöse Lücke" in der Größenverteilung von Himmelskörpern um andere Sterne erklären. Das haben verfeinerte Simulationen einer Forschungsgruppe aus Deutschland und der Schweiz ergeben, die die Beobachtung noch umfangreicher erklären als frühere Erklärungsversuche.
Eine zentrale Rolle nimmt dabei die Wanderung von Exoplaneten in Sternsystemen ein, durch die einst gefrorene Atmosphären tauen und merklich größer werden. Diese Migration der Himmelskörper sei bei den bisher vorgeschlagenen Mechanismen zu Unrecht vernachlässigt worden, erklärt Remo Burn vom Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA).
Bisherige Theorien nicht ausreichend
(Bild: R. Burn, C. Mordasini / MPIA)
Die "Fulton-Lücke" ist ein augenscheinlicher Mangel an Exoplaneten, die um mehr als 75 Prozent größer sind als unsere Erde, aber weniger als zweieinhalbmal so groß. Sie tut sich zwischen den größten Gesteinsplaneten und den kleinsten Eisriesen ("Sub-Neptune") auf. Objekte dieser Größe werden deutlich seltener gefunden, als es laut den Theorien zur Planetenentstehung der Fall sein müsste.
Bislang war vorgeschlagen worden, dass die dichten Atmosphären um die festen Kerne vergleichsweise früh von den jeweiligen Sternen weggedrückt werden – oder dass die Strahlung aus dem Inneren der Himmelskörper das deutlich später im Lebenszyklus der Exoplaneten erledigt. Einer im November vorgestellten Studie zufolge erledigen die Exoplaneten das selbst.
Die Gruppe um Burn weist nun aber darauf hin, dass ihre Simulationen das Fehlen schon viel länger vorhergesagt hätten. Die Lücke ist demnach darauf zurückzuführen, dass sogenannte Sub-Neptune der fehlenden Größe durchaus entstehen, aber weit von den Sternen entfernt. Dort komme die gefrorene Atmosphäre auf die gesuchten Ausmaße. Aber wenn die Objekte im Laufe ihrer Entwicklung aus unterschiedlichen Gründen näher an ihre Sterne heranrücken, taut die Atmosphäre und bläht sich auf. Das führe zur beobachteten Verschiebung bei den Radien. Gleichzeitig schrumpfen Gesteinsplaneten aufgrund der beschriebenen Prozesse, wenn sie ihre Atmosphäre verlieren.
Für die jetzt im Wissenschaftsmagazin Nature Astronomy veröffentlichte Studie waren dem Team zufolge ausreichend gute Daten zum Verhalten von Wasser bei Drücken und Temperaturen nötig, wie sie in den Exoplaneten vorherrschen. Die gebe es erst seit wenigen Jahren. "Es ist bemerkenswert, wie – so wie in diesem Fall – physikalische Eigenschaften auf molekularer Ebene astronomische Prozesse im großen Maßstab, wie die Bildung von Planetenatmosphären, beeinflussen", meint MPIA-Direktor Thomas Henning. Gleichzeitig gesteht das Team ein, dass auch ihre Arbeit noch nicht alle Ungereimtheiten ausräumt. Weitere Analysen sollen bei der Beantwortung der verbleibenden Fragen helfen und auch unser Verständnis von der Wanderung von Planeten vertiefen.
(mho)