Embryonale Stammzellen: Wie ist der Stand nach 25 Jahren Hype?
Forschungshindernisse und Politik haben den Fortschritt verzögert. Dennoch hofft die Wissenschaft auf einen baldigen Durchbruch bei revolutionären Heilmethoden.
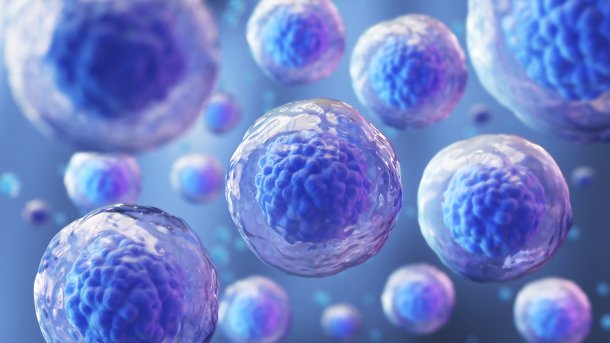
3D-Illustration einer embryonalen Stammzelle.
(Bild: Anusorn Nakdee / Shutterstock)
- Antonio Regalado
Vor 25 Jahren, im Jahr 1998, gelang es Forschern in Wisconsin, erstmals die mächtigen Stammzellen aus menschlichen Embryonen zu isolieren. Das war ein grundlegender Durchbruch für die Medizin, denn diese Zellen sind der Ausgangspunkt für den menschlichen Körper und haben die Fähigkeit, sich in jede andere Art von Zelle zu verwandeln, seien es nun Herzzellen, Neuronen oder jedes andere Gewebe. National Geographic fasste die schier unglaublichen neuen Möglichkeiten später wie folgt zusammen: "Der Traum ist es, eine medizinische Revolution in Gang zu setzen." Kranke Organe könnten durch Stammzellen repariert werden. Der Beginn einer neuen Ära, der heilige Gral – kaum ein Klischee wurde in den Medien ausgelassen.
Doch wo steht die Technik heute? Die Zwischenbilanz ist ernüchternd: Es gibt immer noch keine einzige auf Stammzellen basierende zugelassene Behandlung auf dem Markt. Unsere Suche nach Antworten auf die Frage, warum das alles so lange dauert, begann im Juni diesen Jahres bei der Jahrestagung der Internationalen Gesellschaft für Stammzellenforschung (ISSCR) in einem Auditorium in Boston. Hunderte Biologen und Mediziner waren anwesend. Von der Bühne tönte ein Song von Huey Lewis and the News: "I Want a New Drug". Dahinter waren auf der Leinwand Bilder skurril aussehender Zellen zu sehen.
Während des Treffens gab es für MIT Technology Review die Gelegenheit, alte Bekannte zu treffen – einige von ihnen längst im Wortsinn "alte Hasen", Wissenschaftler also, die sich nach einem Vierteljahrhundert harter Arbeit zu Universitäts- und Institutschefs oder in Managementpositionen als Pharmaberater hochgearbeitet haben. Welchen Fortschritt hat dieses Vierteljahrhundert in der Stammzellforschung gebracht? Worin liegen die Schwierigkeiten? Oder stimmt etwas nicht mit der viel gepriesenen Technologie? Für die meisten Menschen, mit denen wir ins Gespräch kamen, war der lange Zeitraum keine Überraschung. So lange könne es einfach dauern, bis eine wirklich neue Biotechnologie ausentwickelt ist. Das heißt: Der erste Gentherapieversuch am Menschen fand zwar schon 1980 statt, aber erst 2012 wurde das erste Genpräparat in Europa zum Verkauf zugelassen. Nach diesen Maßstäben ist die Stammzellforschung auf dem richtigen Weg.
Schwierige Integration
Andere Forscher räumen ein, dass sich die Integration der Stammzelltechnik in die Medizin als überraschend schwierig erwiesen hat. Die grundlegende Herausforderung besteht darin, dass die Zellen nicht wie Aspirin oder ein anderes Medikament sind, das man tonnenweise herstellen kann. Es handelt sich um lebende Dinge, die sich verändern, absterben oder sogar außer Kontrolle geraten können, wodurch neue Krankheiten wie Krebs entstehen. So gesehen war die Entnahme von embryonalen Stammzellen 1998 der einfache Teil. Die Schwierigkeit besteht nun darin, sie dazu zu bringen, spezialisierte Zellen auszubilden – Zellen mit bestimmten Funktionen, die zur Behandlung von Krankheiten benötigt werden. "Solche Ideen brauchen viel Zeit, aber es ist immer noch die richtige Idee", kommentiert Matthew Porteus, Professor an der Stanford University, der in Boston auf dem Podium stand.
Immerhin: Es gibt Anzeichen dafür, dass stammzellbasierte Therapien endlich vor dem Durchbruch stehen. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2023 wurden in den letzten vier Jahren fast 70 neue Tests an Freiwilligen durchgeführt – eine Verdreifachung des bisherigen Tempos. Die am weitesten fortgeschrittene dieser frühen Studien am Menschen wird von Vertex Pharmaceuticals durchgeführt, das im Juni bekannt gab, dass zwei Diabetes-Patienten, die Injektionen von im Labor hergestellten Pankreaszellen erhalten hatten, kein Insulin mehr benötigen. Bei Tests mit künstlichen Zellen zur Behandlung von Blindheit oder Epilepsie liegen ebenfalls erste Ergebnisse vor, die darauf hindeuten, dass transplantierte Zellen helfen. Einiges stehe vor dem Durchbruch, sagt auch Haifan Lin, Professor an der Harvard University und scheidender Präsident der ISSCR. "Ich würde nicht von einer Verzögerung sprechen, denn Stammzellen sind wirklich die kompliziertesten aller Zellen."
Tabula rasa
Die US-Ausgabe von MIT Technology Review begleitet das Thema von Anfang an. Schon vor 25 Jahren beschäftigte sich ein großer Artikel mit dem Widerstand von Abtreibungsgegnern gegenüber der Isolierung embryonaler Stammzellen. Das Titelblatt der Ausgabe Juli/August 1998 trug die Aufschrift "Biotech-Tabu" und zeigte eine in der Dunkelheit schimmernde Petrischale.
"Wenn Preise für die faszinierendsten, umstrittensten und geheimsten wissenschaftlichen Aktivitäten vergeben würden", hieß es in dem Artikel, "würde die Jagd nach den embryonalen Stammzellen wahrscheinlich die meisten Preise erhalten." Den Lesern wurde erklärt, dass es sich um die Suche nach einer Art Tabula-Rasa-Zelle handelte – einer Zelle, aus der jeder andere Zelltyp im menschlichen Körper entstehen kann. Eine potenzielle "Fabrik in der Petrischale", die Wissenschaftlern zum ersten Mal "die Möglichkeit geben könnte, menschliches Gewebe nach Belieben zu züchten". Das Tabu der Technik war wiederum, dass die Zellen nur in menschlichen Embryonen im Frühstadium existierten. Und diese mussten aus Kinderwunschkliniken gewonnen werden. Bei der Entnahme wurden sie zerstört.
Einige Monate nach dem Bericht war Schluss mit dem wissenschaftlichen Wettlauf, der Sieger gefunden. Im November meldete James Thomson von der University of Wisconsin, dass er Stammzellen aus fünf Embryonen entnommen habe und diese Zellen in seinem Labor am Leben halten und vermehren konnte. Thomsons Arbeit, ein knapper Dreiseiter in der wissenschaftlichen Zeitschrift Science, enthielt eine Skizze, wie Thomsons Meinung nach Stammzellen zu einem medizinischen Verfahren werden könnten. Überall, wo Organe oder Zellen von Spendern knapp sind, lautete seine Vorhersage, werden Stammzellen "eine potenziell unbegrenzte Quelle für die Arzneimittelforschung und die Transplantationsmedizin bieten", insbesondere indem sie eine "standardisierte Produktion" von spezialisierten Zelltypen wie schlagenden Herzzellen oder glukosesensitiven Betazellen ermöglichen. Der Forscher wies darauf hin, dass einige Krankheiten, insbesondere Typ-1-Diabetes und Parkinson, auf das Absterben oder eine Funktionsstörung eines oder weniger Zelltypen zurückzuführen sind. Wenn diese spezifischen Zellen ersetzt werden könnten, würde dies eine "lebenslange Behandlung" ersparen.
Diese Vision – dass jene Mutter aller Zellen jedes Gewebe ersetzen oder sogar Organe nachwachsen lassen könnte – hat eine ganze Generation von Forschern begeistert. "Das war so nah an Magie, mir ist noch nie etwas Ähnliches begegnet. Eine Zelle, die sich teilt und alles herstellen kann. Für eine Zellbiologin ist das der heilige Gral", sagt Jeanne Loring, emeritierte Professorin am Scripps Research Institute und Mitbegründerin von Aspen Neuroscience, einem Unternehmen, das die Parkinson-Krankheit mit der Transplantation von Dopamin produzierenden Zellen behandeln will. "Das Problem ist: Wie macht man aus ihnen genau den Zelltyp, den man haben will?" Außerdem können Stammzellen, wenn sie im Labor vermehrt werden, Mutationen verstärken, was ein potenzielles Krebsrisiko darstellt: "Das ist der dunkle Teil der Magie."
Ein politischer Test
Das Konzept stand schnell vor einer entscheidenden Prüfung – aber es war eine politische, keine wissenschaftliche. Da Stammzellen aus winzigen, aber lebendigen Embryonen aus der künstlichen Befruchtung entnommen worden waren und diese dabei zerstört wurden, stieß der Durchbruch bei der katholischen Kirche und anderen religiösen Organisationen in den USA und anderswo schnell auf Empörung. Zwei Jahre nach Thomsons Veröffentlichung, also im Jahr 2000, wurde dann George W. Bush zum Präsidenten gewählt. Nun hatten die christlichen Konservativen einen direkten Draht ins Weiße Haus und wollten gleich, dass die Bundesmittel für Forschung an solchen Zellen gesperrt werden. Wissenschaftler, unterstützt von Patientenvertretern, reagierten mit einer eigenen Lobbykampagne. Ja zum Heilungsversprechen, riefen sie. "Ich liebe Stammzellen", war auf Autoaufklebern zu lesen.
Diese Gleichung – Stammzellen gleich Heilung – gab den Leuten das Gefühl, dass der Durchbruch näher war als vermutet. Martin Pera, Redakteur des Journals Stem Cell Reports, einer akademischen Fachzeitschrift auf dem Gebiet, ging voran: In einem Leitartikel in jenem Jahr schrieb er beispielsweise, dass Behandlungen "bald" möglich sein würden, wenn nur Regierung und Wohltätigkeitsorganisationen die Wissenschaft finanzieren. "Damals haben wir uns das alles aber nur eingebildet", sagt Pera heute auf der ISSCR-Tagung. "Denn alles, was wir hatten, waren noch nicht ausdifferenzierte Stammzellen." Timothy Caulfield, Professor für Gesundheitsrecht an der University of Alberta, analysierte später die Nachrichtenlage zum Thema und stellte fest, dass die Wissenschaftler durchweg "verbindliche Aussagen" mit "unrealistischen Zeitvorgaben" gemacht hatten, was Therapien anbetrifft. "Ich mache den Forschern keinen Vorwurf", sagt Pera. "Sie hatten ein Mikrofon vor sich und fünf oder zehn Jahre erschienen ihn nah genug, aber auch weit genug entfernt." Revolutionär und aufregend wurde die Technik dementsprechend präsentiert. "Wenn man das nicht macht, fließt das Geld woanders hin."
Aber die Öffentlichkeit glaubte an diese Zeiträume – und auch an die Geschichte, dass nur fehlende Finanzmittel Heilungsverfahren auf Stammzellbasis im Wege stünden. Nachdem die US-Regierung einige Beschränkungen für die Stammzellenforschung eingeführt hatte – unter anderem durch die Reduktion von Fördergeldern auf die Forschung an kleinen Zellvorräten –, schlugen Patientengruppen Alarm. In Kalifornien wurde 2004 durch die Wahlinitiative "Proposition 71" das California Institute of Regenerative Medicine gegründet. Ein Staatengesetz machte die Stammzellenforschung zu einem "verfassungsmäßigen Recht" in Kalifornien und stellte über einen Zeitraum von 10 Jahren insgesamt 3 Milliarden US-Dollar an Steuergeldern für die Forschung bereit. Bis dahin, sagten die Lobbygruppen voraus, würde sich die Initiative durch zahlreiche neue Arbeitsplätze und Heilungsmöglichkeiten gleich doppelt auszahlen. Allein die Behandlung von Typ-1-Diabetes würde 122 Milliarden Dollar an Insulin- und anderen Kosten einsparen, sagte man. In einem Fernsehspot hieß es, Stammzellen könnten "eine Million Parkinson-Kranke" heilen.
Keines dieser Verfahren ist bisher auf den Markt gekommen. Und viele der Patientenvertreter aus jenen Jahren, von denen einige hofften, dass Stammzellen sie retten könnten, sind jetzt tot: Jenifer Estess, David Ames, der Schauspieler Christopher Reeve und Jordan Klein beispielsweise. Letzterer war der Sohn von Bob Klein, einem kalifornischen Immobilienunternehmer, der Proposition 71 überhaupt erst auf den Weg gebracht hatte. Nachdem Jordan 2016 im Alter von 26 Jahren an den Folgen von Typ-1-Diabetes gestorben war, machte sein Vater dafür laut dem Long Beach Business Journal politische Verzögerungen verantwortlich. "Mein jüngster Sohn ist gestorben. Wenn sie das in Washington nicht aufgehalten hätten, wäre er noch am Leben", sagte Klein der Publikation.
Der Glaube an die Stammzelltherapien hatte sich schnell verfestigt. Für Menschen wie Klein war es politische Einmischung, die sie verzögerte. "In den frühen 2000er Jahren gab es diese dystopische Vorstellung von Stammzellen", sagt Gesundheitsrechtler Caulfield. "Es gab Leute, die sagten, es sei unethisch oder unmoralisch und sollte nicht erlaubt werden." Die Wissenschaft habe reagieren müssen und propagiert, dass die Technik sehr spannend sei und Leben retten werde. "Und all diese Formulierungen haben sich erhalten." Der deutlichste Beweis? Zwielichtige Kliniken, die mit dem Hype um Stammzellen Geld verdienen und Heilmittel für Autismus, Migräne und Multiple Sklerose anpreisen, ein Phänomen, das Caulfied als "Ausbeutung durch Wissenschaft" bezeichnet. Viele Jahre lang konnte man bei einer Google-Suche nach Stammzellen solche Anzeigen von zwielichtigen Kliniken finden, die anboten, so ziemlich alles zu behandeln –in der Regel mit Zellen, die aus Blut oder Fettgewebe gewonnen wurden.
Verspätete Verheißung
Solche Betrügereien sind weit verbreitet. Eine ältere Frau gab 7000 Dollar in bar aus, um sich angebliche Stammzellen gegen schmerzende Knie injizieren zu lassen. Gebracht hat es selbstverständlich nichts. Die ISSCR selbst versucht, mit einer Warnbroschüre auf das Phänomen solcher Kliniken aufmerksam zu machen. Unter dem Titel "Guide to Stem Cell Treatments" wird ausführlich vor Nepp gewarnt. Kernaussage: Praktisch jede Stammzellenbehandlung, für die heute geworben wird, ist Fake.
Die Wissenschaft braucht eben noch. "Als das Versprechen der Stammzellen das öffentliche Bewusstsein erreichte, gab es die Idee, dass sie selbst ein magisches Heilmittel sind, obwohl das lächerlich war", sagt Arnold Kriegstein, Professor an der University of California, San Francisco. "In Wahrheit waren sie nur der Ausgangspunkt für die gewünschten Zellen. Und so etwas ist niemals einfach. Die Forschung ist mühsam und langsam. Das ist echte Wissenschaft – sie braucht Zeit."
Gewünschte Zellen per "Kochbuch-Verfahren"
Die Stammzellenforschung ist nicht mehr so politisch, wie sie es einmal war. Das liegt zum Teil daran, dass Wissenschaftler 2006 herausgefunden hatten, wie man jede beliebige Zelle, z. B. ein Stück Haut, in eine Art embryonale Stammzelle umwandeln kann. Solche "induzierten" Stammzellen sind weitgehend identisch mit denen von Embryonen – und zwar ohne die ethischen Probleme. Doch egal, für welche Art von Stammzellen sich die Forscher auch entscheiden, ihre Verwendung zur Herstellung reifer spezialisierter Zellen (also jene Art, die man für eine Transplantation benötigt) hat sich als schwieriger erwiesen als erwartet.
Die Strategie, die die Wissenschaftler anwenden, um die gewünschten Zelltypen zu erzeugen, nennt sich "gerichtete Differenzierung". Man kann sich das wie ein Kochbuch vorstellen, bei dem man jenen Wachstumsfaktor am zweiten Tag hinzufügt, einen anderen am zwölften Tag und so weiter. Eine Stammzelle wird dadurch denselben äußeren Reizen ausgesetzt, die sie als Teil eines sich entwickelnden Babys erhalten würden. Dieses "Kochbuch-Verfahren" kann zwar erfolgreich sein, aber es ist außerordentlich schwierig, das richtige Rezept zu finden. Der Wissenschaftler Douglas Melton zum Beispiel, der zwei Kinder mit Typ-1-Diabetes hat und der die sogenannte Vertex-Behandlung entwickelt hat, die jetzt getestet wird, brauchte fast 15 Jahre, bevor er in der Lage war, "funktionelle" Bauchspeicheldrüsenzellen herzustellen, die auf Glukose reagieren und Insulin produzieren, wenn sie in eine Maus transplantiert werden. "Die Bewältigung des Problems hat viel länger gedauert, als ich erwartet hatte – ich habe meiner Frau gesagt, dass es fünf Jahre dauern würde", erzählte Melton 2021 in einer Harvard-Publikation.
Hinzu kommt, dass die Reifung von Stammzellen zu einem gewünschten Zelltyp im Labor fast so lange dauern kann wie bei einer tatsächlichen Schwangerschaft – manchmal sechs oder sieben Monate. Das ist ein erhebliches Hindernis für das Ausprobieren neuer Ideen, denn jeder neue Test bedeutet eine weitere lange Verzögerung. "Ich war zunächst optimistisch, aber wenn man ein Experiment durchführt, kann es 200 Tage dauern", sagt Hanae Lahlou, leitende Wissenschaftlerin am Mass Eye and Ear, einem der Lehrkrankenhäuser der Harvard University. Die Forscherin war Teil eines Projekts, bei dem versucht wurde, das Gehör von Meerschweinchen durch Transplantationen zu reparieren. Die Gruppe hoffte, dass die transplantierten Zellen zu neuen Hörhärchen heranwachsen würden, aber das gelang nicht. Jetzt versucht Lahlou es mit schnelleren genetischen Techniken als mit Zelltransplantationen. "Irgendwann habe ich die Technik nicht mehr als therapeutisches Mittel gesehen", sagt sie. "Und wenn man die Patienten fragt, wollen die ein Medikament."
Versuche weiter im Frühstadium
Hinzu kommt: Die Herstellung von Stammzellen ist auch nicht billig. Ein einziges Gramm eines der beliebtesten Wachstumsfaktoren kostet 750.000 Dollar. Wenn man dann noch die regulatorischen Hürden hinzunimmt, mit denen jeder neue Ansatz konfrontiert ist, wird klar, warum die Arbeit der Biotechnologieunternehmen so unbeständig war. Die Firma Geron, die einst ein Patent auf bestimmte embryonale Stammzellen besaß und 2010 den ersten Test einer aus ihnen hergestellten Therapie am Menschen durchführte, brach ihre Studie ein Jahr später ab. Jetzt arbeitet das Unternehmen an Krebsmedikamenten und erwähnt embryonale Stammzellen auf seiner Website gar nicht mehr. Eine andere Stammzellfirma, Sana, hat seit seinem Börsengang im Jahr 2021 viel an Unternehmenswert verloren und im vergangenen Jahr sogar ein Team entlassen, das versucht hatte, Herzmuskelzellen zur Behandlung von Herzkrankheiten zu erzeugen.
Hohe Kosten und technische Schwierigkeiten sind in der Biotech-Welt nichts Ungewöhnliches. Außerdem gibt es immer noch eine widerstandsfähige Schar von Investoren und Wissenschaftlern, die glauben, dass Stammzelltherapien das Risiko wert sind. Heute sagen Stammzellenforscher, dass die steigende Zahl neuer klinischer Studien – etwa 15 werden jedes Jahr gestartet – ein Zeichen dafür ist, dass das Feld kurz vor einem Wendepunkt steht. Die Transplantation von im Labor hergestellten Netzhautzellen verbessert zwar noch nicht das Sehvermögen, aber Arbeiten an der ersten Handvoll Patienten zeigt, dass die Zellen etwas bewirken. Laut einer im vergangenen Jahr veröffentlichten Übersichtsstudie haben bislang mehr als 3000 Patienten in rund 90 Studien Transplantate aus induzierten oder embryonalen Stammzellen erhalten. Die Forschung ist aber erst am Anfang.
"Wenn man sich umschaut, befinden sich alle Versuche in einem frühen Stadium. Nicht alle werden wahrscheinlich zu Therapien führen, aber sie werden uns Informationen darüber liefern, wie wir die Dinge verbessern und verfeinern können", sagt Experte Pera. Bei den zu transplantierenden Zellen ist eine offene Frag, wie lange sie überleben werden. Das lässt sich nur am Menschen testen. Denn wenn dopaminproduzierende Neuronen in die Gehirne von Parkinson-Patienten implantiert werden, was schon einige Male versucht wurde, sterben die meisten dieser Neuronen ab. Manche Forscher mussten ganz von vorne beginnen.
Neuronen bilden
Vielleicht muss man einfach die Dosis erhöhen. Doch zu viel Dopamin ist fast so schlimm wie zu wenig, es führt zu unwillkürlichen Bewegungen. Die Vertex-Studie zu Diabetes, in der 40 Personen behandelt werden sollen, sieht bislang vielversprechender aus – aber auch hier bleibt unklar, wie lange die Zellen im Körper überleben werden. Das bedeutet, dass eine sehr kostspielige Behandlung (vermutlich eine halbe Million Dollar) möglicherweise nicht ewig hält. Scripps-Forscherin Loring ist jedoch zuversichtlich, dass einer dieser Studien bald den unwiderlegbaren Beweis dafür liefert, dass aus embryonalen Stammzellen hergestellte Therapien Krankheiten heilen können. "Das könnte der Wendepunkt sein", sagt sie. Auf diesen Moment warte der Sektor.
Eine neue Studie sieht indes nach einem großen Durchbruch aus. Das Biotech-Unternehmens Neurona Therapeutics in San Francisco hat sogenannte hemmende Interneuronen geschaffen, die Menschen helfen sollen, deren hartnäckige Epilepsie auf herkömmliche Medikamente nicht ansprach. Die Hoffnung ist, dass diese zusätzlichen Zellen tief im Gehirn jeweils Tausende von Nervenverbindungen bilden und die schlecht funktionierenden Neuronennetze, die Anfälle verursachen, zum Schweigen bringen.
Epilepsie-Behandlung
Während des ISSCR-Treffens gab Neurona bekannt, dass bei zwei Patienten die Anfälle um mehr als 90 Prozent zurückgegangen seien. Bei einem 26-jährigen Mann waren es zuvor 32 Anfälle pro Monat gewesen. Wenn sich die Daten bestätigen, könnte das bedeuten, dass die Zelltransplantation ebenso wirksam ist wie die drastischste derzeit verfügbare Behandlung von Epilepsie – nämlich die chirurgische Entfernung eines Teils des Schläfenlappens. Allerdings hätte die Transplantation nicht die Nebenwirkungen, die bei der Entfernung eines Teils des Gehirns auftreten, wie etwa Gedächtnisverlust und Sehprobleme.
"Der Enthusiasmus ist groß. Das könnte die erste Zelltherapie für Epilepsie sein", sagt der University-of-California-Professor Kriegstein, der auch Berater von Neurona und Mitbegründer des Unternehmens ist. Er glaube nicht, dass 25 Jahre eine lange Zeit für die Entwicklung dieser Art von Therapien sei. "Im Gegenteil, das geht eigentlich ziemlich schnell." Ärzte hatten bereits zuvor mit Nervenzelltransplantationen experimentiert – ein Unternehmen versuchte es mit Zellen von Schweinen. Aber es war erst Cory Nicholas, Postdoktorand in Kriegsteins Labor, der 2013 erstmals herausfand, wie embryonale Stammzellen dazu gebracht werden können, menschliche Interneuronen in großen Mengen zu bilden.
Rationale Schritte
Es folgte eine Reihe von – wie Kriegstein es nennt – "rationalen systematischen Schritten" über ein Jahrzehnt hinweg, um das Rezept zu verbessern, Tests an Versuchstieren durchzuführen und die Genehmigung für eine Studie am Menschen zu erhalten. Der größte Teil dieser Arbeit wurde bei Neurona geleistet, einem Unternehmen, das inzwischen über 160 Millionen Dollar an Investorengeldern eingeworben hat und dessen CEO Nicholas ist.
"Ohne embryonale [oder induzierte] Stammzellen wäre dies natürlich nicht möglich", sagt Kriegstein. Da erst zwei Patienten behandelt wurden, sind die Ergebnisse von Neurona nur anekdotisch. Aber es besteht die Chance, dass es sich tatsächlich um ein Heilverfahren handelt. Das liegt daran, dass die transplantierten Zellen die Verbindungen halten und ihre Wirkung mit der Zeit sogar zunimmt, wodurch Anfälle möglicherweise ganz verhindert werden können.
"Zuerst schien es wie ein Hirngespinst, aber die Möglichkeit, diese Zellen in unbegrenzter Anzahl herzustellen, hat uns den Versuch wagen lassen. Jetzt haben wir Patienten, denen geholfen werden konnte. Es ist wirklich erstaunlich, wenn man darüber einmal nachdenkt", sagt Kriegstein. "Die Zellen befinden sich in den Patienten und wir können jetzt sehen, wie gut sie funktionieren." Das sei doch kein Hype. (bsc)